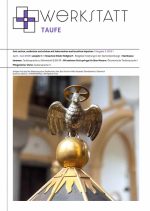Die Erinnerungskultur in Bezug auf den 2. Weltkrieg und die schrecklichen Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus ist nach wie vor stark in Deutschland. Es ist ein hohes Gut, nicht wegzusehen von der eigenen Schuld. Doch grade direkt nach dem Krieg waren derartige Gedanken noch nicht besonders ausgeprägt. Einen ersten Impuls in diese Richtung setzte das Stuttgarter Schuldbekenntnis schon 1945.
Die Schuldfrage
Mitte Oktober 1945 kamen Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen in das stark zerstörte Stuttgart, um erstmals dem neu gegründeten Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu begegnen. Die Gäste aus den Niederlanden, der Schweiz, aus den USA, England und Frankreich, deren Länder noch vor wenigen Monaten mit Deutschland im Kriege gestanden hatten, wollten mit der Führungsriege der neu gebildeten EKD erste vertrauensbildende Schritte wagen.
Die Erwartung, dass sich die deutschen Kirchenvertreter bei dieser Begegnung auch zur Schuldfrage äußern würden, stand im Raum – und sie wurde erfüllt: „Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden“, formulierte der Rat der EKD am 19. Oktober 1945 und fügte hinzu: „Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“
Empörte Öffentlichkeit
Das Echo in der deutschen Öffentlichkeit auf diese Erklärung war verheerend. Zahllose Briefe protestierten verständnislos gegen das Stuttgarter Schuldbekenntnis, in dem man einen „Canossagang vor den Vertretern der fremden Kirchen“ zu erkennen glaubte. Die Debatte um die deutsche Schuld beschäftigte die Öffentlichkeit – während Nachrichten von weitergehenden brutalen Misshandlungen und Vertreibungen aus ehemals deutschen Ostgebieten die Zeitungen füllten. Es brauchte Zeit, bis der Rat der EKD in umfänglichen Kommentaren seine Position erläutern konnte.
In der Stuttgarter Erklärung fehlte jedes Wort zur kirchlichen Mitschuld am Holocaust – dies blieb ebenso einem späteren Zeitpunkt vorbehalten wie eine differenziertere Wahrnehmung des Weges, der Deutschland in den Zweiten Weltkrieg geführt hatte. Und dennoch setzte die Schulderklärung ein Zeichen, das von ihren Adressaten entsprechend verstanden wurde. Es wuchs nach den Gräueln des Krieges gegenseitiges Verständnis unter den Kirchenvertretern, die in den Trümmern ihrer Städte und der weltweiten Friedensidee einen neuen, glaubwürdigen Anfang suchten – und ihn fanden. Stärker als die bitteren Ressentiments war der Wille zur Versöhnung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Redationsteam
vom Gemeindeportal
Verbindung schaffen und Segen zusagen
WERKSTATT Taufe
Egal, ob Eltern ihr Kind taufen lassen oder sich Jugendliche oder Erwachsene für das Sakrament entscheiden: Die Taufe ist ein großes, einmaliges und herausragendes Ereignis, das einen würdigen und besonderen Rahmen verdient. Dabei hilft Ihnen WERKSTATT Taufe.