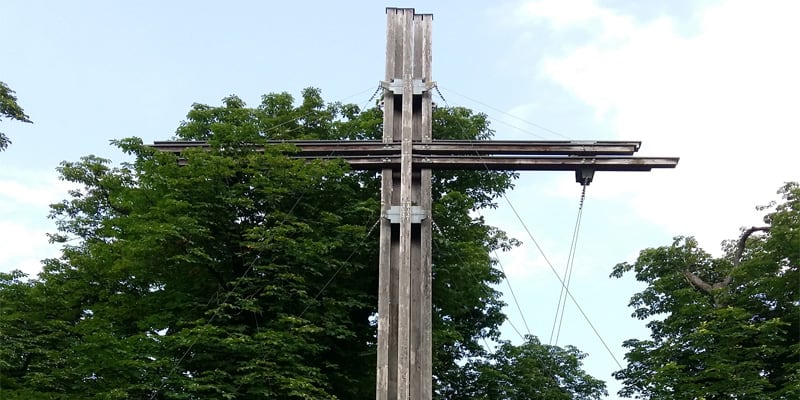Was bedeutet eigentlich dieses Wort „Glauben“? Im Gegensatz dazu, was mancher glauben mag, ist es gar nicht so leicht genau zu definieren, worüber hier gesprochen wird, da es verschiedene Ansätze des Verstehens gibt. Geben wir einer dieser Sichtweisen eine Perspektive.
Bedeutungsunterschiede
Die Bedeutungsunterschiede des Wortes „glauben“ werden im christlichen oder kirchlichen Sprachgebrauch leider nicht immer berücksichtigt. So hat man in der Reformationszeit heftig über diesen Begriff gestritten, ohne zu beachten, dass man dabei aneinander vorbeiredete. Während Luther sich auf die Aussage des Römerbriefs berief, „dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes“ (3,28, vgl. auch Gal 2,16), führte die katholische Seite die Feststellung des Jakobusbriefs ins Feld, „dass der Mensch aufgrund seiner Werke gerecht wird, nicht durch den Glauben allein.“ (2,24) Dabei wurde – vielleicht geflissentlich – übersehen, dass das Wort „glauben“ an beiden Stellen in unterschiedlichem Sinn verwendet wird. Versteht man nämlich unter „Glauben“ die Hingabe an Gott, dann ist dieser Glaube allein für das Heil des Menschen entscheidend: „Wer an ihn (den Sohn Gottes) glaubt, wird nicht gerichtet“ (Joh 3,18). Diese Bedeutung des Wortes „glauben“ herrscht bei Paulus und im ganzen Neuen Testament vor. Wo hingegen mit „glauben“ das Für-wahr-Halten von Aussagen gemeint ist, genügt er keineswegs. Daher schreibt Jakobus: „Du glaubst: Es gibt nur den einen Gott. Damit hast du recht; das glauben auch die Dämonen, und sie zittern.“ (2,19)
Hingabe und Wahrheit
Abweichend vom Sprachgebrauch des Neuen Testaments steht heute auch innerhalb der Kirche jedoch das Fürwahr- Halten von Lehren im Vordergrund, wenn vom Glauben die Rede ist. Dadurch entsteht eine falsche Gewichtung. Denn der Hingabeglaube ist entscheidender als der Satzglaube. Wenn Christus von seinen Jüngern und auch von uns fordert: „Glaubt an Gott, und glaubt an mich!“ (Joh 14,1), geht es offenbar nicht um irgendwelche Lehren, sondern er verlangt diese Hingabe an ihn, die in vollem Sinn nur Gott zusteht, dem er sich damit gleichstellt, und die natürlich einschließt, dass wir seinen Aussagen vertrauen. Für das Heil oder Unheil des Menschen kommt es allein darauf an, diesen „Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist.“ (Gal, 5,6); denn ohne diesen Glauben kann niemand gerettet werden (vgl. Mk 16,16, Joh 3,18). Er ist daher gewiss auch vielen Menschen zu eigen, die sich dessen nicht bewusst sind, die sich aber selbstlos für ihre Mitmenschen, für Wahrheit und Gerechtigkeit einsetzen und eben damit Jesus hingeben.
Warum brauchen wir dann überhaupt den Glauben in der anderen Bedeutung, der besagt, dass wir die Lehren des Christentums als wahr annehmen, auf den die Kirche so sehr Wert legt? Der Hingabeglaube betrifft die Grundeinstellung unseres ganzen Lebens. Daher ist es sehr wichtig zu bedenken, an wen ich mich da hingebe, ob an Gott oder ein zurechtgemachtes Götzenbild oder eine ideologische Figur. Die Lehre des Christentums, die konzentriert ist auf Christus, das Wort Gottes, informiert nun darüber, wer dieser Gott ist, auf den ich mein Leben gründen soll. Deswegen ist sie unentbehrlich. Für den entscheidenden Hingabe-Glauben aber ist nicht diese Lehre das Ziel. Der geht auf Gott, wie er sich uns in Christus zeigt. An den sollten wir glauben und alles andere nur annehmen, weil und insofern es uns zu diesem Ziel hinzuleiten vermag. Der Satzglaube ist nur ein freilich unentbehrliches Mittel zum Hingabeglauben.
Auf Jesus Christus hin
Von Gott können wir nämlich nach einer Aussage Thomas von Aquins nicht wissen, wer er ist, sondern nur, was er nicht ist und wie die Dinge dieser Welt sich zu ihm verhalten. Wie er ist, vermögen wir nur an Christus zu erkennen, der von sich sagt: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (Joh 14,9), und „Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will.“ (Mt 11,27). In ihm ist alles gesagt, was Gott von sich mitteilen will, und darüber hinaus gibt es nichts zu sagen. Folglich gibt es nach Christus auch keine neuen Offenbarungen mehr, und auch die Kirche kann keine neuen Lehren vorlegen, sondern nur jeweils neu erläutern, was Gott ein für alle Mal in der Person Christi von sich kundgetan hat.
Das bestimmt auch unsere Einstellung zur Heiligen Schrift. Wie die übrige Lehre der Kirche, ist auch sie nicht Ziel, sondern Mittel unseres Glaubens, insofern sie uns den Zugang zum Wort Gottes schlechthin, nämlich zu Jesus Christus erschließt. Nur deswegen und indirekt kann sie selbst „Wort Gottes“ genannt werden, obwohl sie zunächst Menschenwort ist. Im Neuen Testament ist sie zudem Schrift der Kirche, nämlich das von ihr als verbindlich anerkannte Glaubenszeugnis der ursprünglichen christlichen Gemeinde, in der noch die Zeugen lebten, die Jesus persönlich gekannt und erlebt hatten. Auch das Alte Testament ist deshalb und insofern Wort Gottes, weil es uns den Zugang zu Jesus erschließt, der in seiner Tradition lebte und nur von ihr her recht zu verstehen ist. Der christliche Glaube geht nämlich letztlich nicht auf Sätze, sondern über sie hinaus nur auf Jesus Christus und in ihm und durch ihn auf Gott.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Redationsteam
vom Gemeindeportal
Beiträge passend zum Thema
Verbindung schaffen und Segen zusagen
Egal, ob Eltern ihr Kind taufen lassen oder sich Jugendliche oder Erwachsene für das Sakrament entscheiden: Die Taufe ist ein großes, einmaliges und herausragendes Ereignis, das einen würdigen und besonderen Rahmen verdient. Dabei hilft Ihnen BOTSCHAFT Taufe.